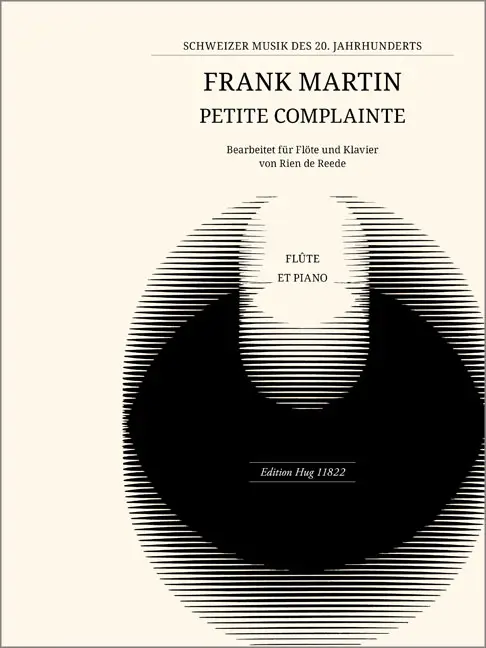Eine erfreuliche Neuerscheinung: die Bearbeitung von Rien de Reede eines für den Genfer Musikwettbewerb 1941 komponiertes „Morceaux de lecture“ für Oboe und Klavier. Martin ging dabei von einem Fragment seines Ballettes „Das Märchen vom Aschenputtel“ aus. Nach einer nachdenklichen Einleitung und einem Andantino folgt ein walzerartiger Teil im Dreivierteltakt in wechselnden Tempi. Ob man aus dramatischen Gründen die 32tel-Stelle in der Einleitung tatsächlich oktaviert, sollte jeder Flötist selbst entscheiden – wenn er denn einen H-Fuß besitzt. Das Stück in seiner schönen Melancholie erscheint mir auch sehr geeignet für den Unterricht – und die vielen
Aufführungen des Oboisten Heinz Holliger sprechen auch für seine Qualität
Frank Michael (TIBIA Portal für Holzbläser, 16.12.2025)
Die Querflöte und die Oboe vereint eine lange Geschichte des gemeinsamen musikalischen Einsatzes; was liegt da näher, als sich gelegentlich auch die Solo-Literatur zu teilen? Immer wieder übernehmen Solistinnen und Solisten Repertoire-Stücke in ihr eigenes Konzertprogramm, schreiben um, adaptieren, ergänzen – kurz: eignen sich für ihr Instrument ikonische Werke anderer Klangfarben an. Dass sich hierbei die vom Komponisten intendierten Klangvorstellungen ändern und instrumentenspezifische Zugangsweisen Interpretationen maßgeblich beeinflussen, ist eher ein aufführungspraktisches Thema und soll zu Gunsten der Repertoireerweiterung hintangestellt werden. Manchmal jedoch scheint die Bearbeitung klanglich in geradezu idealer Weise in der Komposition selbst angelegt zu sein. Oftmals sind es auch die Komponisten selbst, die ihre Musik aus den praktischen Erfordernissen heraus oder nach Wünschen von InstrumentalistInnen adaptieren. Frank Martin legte diesbezüglich des Öfteren Hand an eigene Werke; wie man z. B. an der Sonata da chiesa pour viole d’amour et orgue (1938) und ihren verschiedenen Instrumentalversionen verfolgen kann: 1941 entstand eine Version für Flöte und Orgel sowie für Oboe d’amore und Orgel, später dann eine Version für Viola d’amore und Streichorchester (1952) sowie weitere Fassungen. Spätestens seit Frank Martin für den 1939 gegründeten Concours in Genf – bis heute wohl einer der wichtigsten musikalischen Wettbewerbe der Welt – seine Ballade für Flöte und Klavier schrieb, ist offenbar, wie vertraut und selbstverständlich der Komponist mit den Möglichkeiten der Flöte umgeht. So liegt auch in der Bearbeitung der Petite Complainte die Flöte als Solo-Instrument gleichsam in der Luft: Die Komposition basiert auf einem Morceau de lecture für Oboe, bezugnehmend auf die Ballettmusik Das Märchen vom Aschenbrödel, und ist wie geschaffen für die spieltechnischen und klanglichen Möglichkeiten der Flöte. Die Originalversion für Oboe und Klavier wurde beim schon erwähnten Wettbewerb in Genf uraufgeführt (1941). Eine kleine Änderung zum Original wurde durch Rien de Reede vorgenommen, der zugleich Bearbeitung und Herausgabe verantwortet: In Takt 14 oktaviert die Flöte, was musikalisch absolut intendiert und logisch ist. Der Druck beider Stimmen ist großzügig und übersichtlich gesetzt, rein formal sind alle Voraussetzungen zum Erarbeiten des ca. vierminütigen Konzertstücks sehr gut. Absolut lohnend und im besten Sinne flötistisch intendiert wird dieses Kleinod sicher in Zukunft häufig in Konzerten oder bei Vorspielen fortgeschrittener SchülerInnen zu hören sein: In der kadenzartigen Einleitung kann gleich mit Flötenklang und schönem Ton gezaubert werden, rhythmisch interessante Passagen finden sich im weiteren Verlauf (Andantino, Allegretto), um dann ab Takt 64 im cantablen Zwiegespräch mit dem Pianisten zart auszuklingen.
Christina Humenberger (üben & musizieren 4/2025)